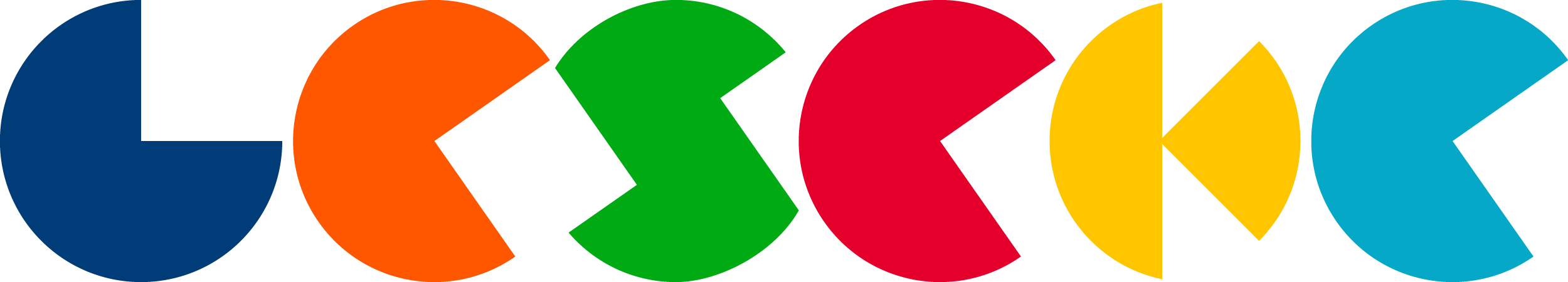Pressemitteilungen (Archiv)
Städtisches Hellwegmuseum - Ausstellungsstück des Monats Juni

Das Ausstellungsstück des Monats Juni im Hellwegmuseum ist ein sogenanntes Schächtmesser. Anhand einer Ritzung am Griff lässt sich bei der Datierung auf das Jahr 1741 schließen. Im Inventarverzeichnis des Museums aus dem Jahr 1927 lässt sich folgendes finden: "1 Schächte-Messer von 1741 Fundort: Vermerk A.E. [Museumsleiter Anton Engels] gefunden im Hause Ant. Trugge, Hellweg, für [früher?] Hodenberg, vor-dem Meierhof". Es wurde von Rechnungsrat Hillenkamp geschenkt.
Das Schächtmesser, oder jüdisch "Chalaf" genannt, ist ein jüdisches Schlachtmesser. Das vordere Ende des Schächtmessers scheint gerundet gewesen zu sein. Es weist am Rücken der Klinge einen Ausbruch auf. Das Schlachtmesser besitzt eine 52cm lange, gerade Klinge. Eine so lange Klinge ist nötig, um eine Schächtung an einem Rind durchführen zu können. Das Schlachten hat im Judentum einen rituellen Status. Um die Erlaubnis zu erwerben, die "Schechita" auszuüben, musste ein Diplom erworben werden. Der Kandidat musste das Schächten in Anwesenheit eines Rabbiners vollziehen, der auf den korrekten Ablauf und die einwandfreie handwerkliche Ausübung achtete. Beim Schächten soll dem Tier möglichst kein Schmerz zugefügt werden. Laut den Bestimmungen muss ein Schächtmesser mindestens doppelt so lang sein, wie der Hals des zu schlachtenden Tieres breit ist. Zudem darf das Messer keinerlei Beschädigungen oder Scharten aufweisen. Beim Schächten wird das Tier durch einen langen Schnitt an der Kehle getötet. Es muss laut jüdischem Speisegesetz (Kaschrut) vollständig ausbluten. Nachdem das Tier geschlachtet ist, wird es begutachtet. Es wird auf Unregelmäßigkeiten wie Geschwüre und Ähnliches geachtet. Sollten solche am Fleisch zu sehen sein, gilt es als nicht koscher und darf von gläubigen Juden nicht verzehrt werden. Blutrückstände werden abgewaschen oder durch Salzung entfernt.
Die Schächtung von Tieren ist in Deutschland heute laut Tierschutzgesetz grundsätzlich nicht mehr erlaubt, da eine rituelle Schächtung ohne vorherige Betäubung erfolgt. Es gibt jedoch Ausnahmen, die aus religiösen Gründen gewährt werden.
Betrachtet man Geseke zur Entstehungszeit des Messers, also die Mitte des 18 Jahrhunderts, so finden sich ca. 13 jüdische Familien in Geseke. Die Zahl der jüdischen Familien stieg in den folgenden Jahren weiter an. Somit ist es nicht verwunderlich, dass zum jüdischen Leben in Geseke ein Metzger nötig war, der nach jüdischem Ritual schlachten durfte. Es ist davon auszugehen, dass nicht nur jüdische Familien Kunden dieser Metzger waren. Der Fleischbedarf der jüdischen Familien hätte wohl nicht für den Unterhalt eines Metzgers reichen können. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass in Geseke, wie andern Ortes auch, neben den Juden auch andere Bürger der Stadt dort gekauft haben.
Als zweites Argument für diese These lässt sich anführen, dass Mitte des 18. Jahrhunderts die Hauptlieferanten für Frischfleisch der kaiserlichen und französischen Truppen, welche 1757 in das Amt Erwitte einrückten, unter den Geseker Juden zu finden waren. Dies spricht außerdem dafür, dass es sich bei den Metzgern um professionelle Betriebe gehandelt haben muss und um keine Hausschlachtung, da ansonsten die Masse an benötigtem Fleisch nicht hätte verarbeitet werden können.
(Autor: Jan Eiserich)
Städtisches Hellwegmuseum Geseke, Hellweg 13, 59590 Geseke, Tel. 02942/500949
Öffnungszeiten: mittwochs von 17:00 ? 19:00 Uhr, samstags und sonntags von 11:00 - 18:00
Suche
Kategorien
Datum
Aktuelles
Info: Das Archiv enthält Pressemitteilungen, die älter als 12 Monate sind. Alle jüngeren Pressemeldungen sind hier zu finden.