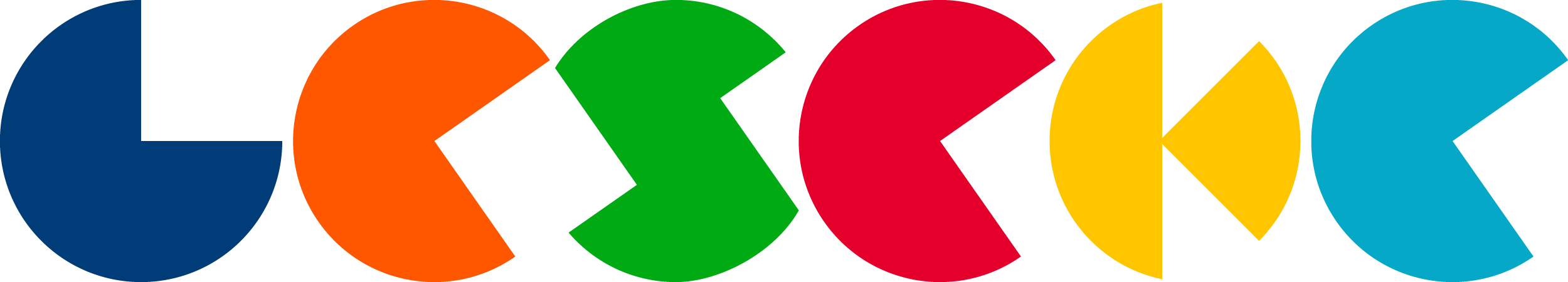Pressemitteilungen (Archiv)
Serie "Ausstellungsstück des Monats" widmet sich dem Dreißigjährigen Krieg

1622 belagerte Christian von Braunschweig Geseke - vergeblich. Während viele westfälische Städte erobert und ausgeplündert wurden, konnte das katholische Geseke mit Hilfe kaiserlicher Truppen widerstehen. Das Ereignis prägte sich tief ein in das historische Gedächtnis der Bürger. Für die Errettung gelobten die Geseker, jährlich eine Prozession durchzuführen. Aus Anlass ihres 400. Jahrestags soll monatlich ein Exponat aus dem Städtischen Hellweg-Museum vorgestellt werden, das zu den Ereignissen im Dreißigjährigen Krieg in Bezug steht.
Nachdem Christian von Braunschweig abgezogen war, sammelten die Geseker einige Hinterlassenschaften der Braunschweiger ein und verwahrten sie im Stadtkirchturm als Andenken. Dazu gehört der sogenannte Torausheber (Inv.-Nr. 0000.229). Es handelt sich um einen heute insgesamt zwei Meter langen Holzschaft, an dem eine massiv schmiedeeiserne, halbrund geformte Gabel mit zwei Auflagern befestigt ist. Wie das Pendant zu den Eisenbändern, die zur Befestigung dienen, sah ursprünglich wohl eine Spitze am anderen Ende aus. Sie ging im letzten oder vorletzten Jahrhundert bei einer Neuschäftung verloren.
Die Tradition besagt, dass die Truppen des Braunschweigers mit Hilfe dieses Auflagers versucht hätten, die Stadttore aus den Angeln zu heben. Das wurde z.B. auch im Katalog der Ausstellung "1648 – Krieg und Frieden in Europa" so übernommen: " … Stützgabel eines Türhebers … ; mit diesem Gerät konnte ein eingelegter Hebebalken abgestützt werden, um ein Stadttor aus den Angeln zu heben". Das Stück war 1998/99 in der Ausstellung in Münster zu sehen. In der Geseker Stadtgeschichte fällt die Formulierung schon vorsichtiger aus.
Sieht man sich die Konstruktion eines Stadttores an, wird man schnell bemerken, dass seine Erbauer die Möglichkeit, ein Tor aus den Angeln zu heben, durchaus im Blick hatten. Die schweren Tore ruhten unten in Findlingen und verfügten oben über ein entsprechendes Gegenlager. Die Tore lagen oben zudem üblicherweise an einem Sturz aus Stein oder Holz an, was ein Heraushebeln unmöglich machte.
So kommen Zweifel, ob die gegnerischen Truppen sich wirklich mit zwei Balken, dem Stütz- und dem Hebebalken, auf den gefährlichen Weg durch das Abwehrfeuer der Verteidiger gemacht haben sollen, um auszuprobieren, ob man mit diesem Hebewerkzeug eventuell doch etwas ausrichten könnte. Die Spitze der Stützgabel an der Unterseite könnte zwar ein Verrutschen in weichem Untergrund verhindern, beim Hebeln würde sie sich jedoch auch eindrücken.
Die U-förmige Gabel mit den beiden halbrunden Enden erinnert an die Halterungen, in denen die Zapfen von Geschützrohren jener Zeit auflagen. Das führte zu Spekulationen, es könne sich um eine Art Geschützgabel handeln, ähnlich der einer Musketengabel. Musketengabeln waren tatsächlich im Dreißigjährigen Krieg noch in Gebrauch. Es handelt sich dabei zumeist um hölzerne Stäbe mit einer Gabel am oberen Ende, auf die die Musketen zum Schuss aufgelegt werden mussten, da sie zu der Zeit konstruktionsbedingt für ein freihändiges Zielen und Abfeuern zu schwer waren.
Dennoch muss man die Spekulation, der Geseker "Torausheber" könne einem ähnlichen Zweck gedient haben, als unhaltbar ansehen. Die massive Gabel von 27,5 cm Breite wäre von der Abmessung her geeignet, ein Rohr von etwa 16 cm Durchmesser aufzunehmen. Ein solches Geschütz würde mindestens 60 Kilogramm wiegen. Selbst die kleinsten Geschütze, sogenannte Serpentinells mit einem Kaliber von rund 3,5 cm, wogen bei einer Länge von beispielsweise 1,7 m schon 35 Kilogramm. Üblicherweise waren sie auf einer Lafette montiert, zumindest aber auf einem Dreibein. Somit waren sie schnell in Position zu bringen. Sie wurden eingesetzt gegen Stellungen, beispielsweise um gezielt Offiziere anzugreifen. Zum Beschuss von Mauern und Toren waren sie nicht geeignet.
Um als Auflager für ein kleineres Geschützrohr zu dienen, hätte der zwei Meter lange "Torausheber" zunächst fast einen Meter eingegraben werden müssen, was besonders bei felsigem Untergrund kein Vergnügen gewesen sein dürfte. Beim Eingraben hätte man auch schon die Schussrichtung vorgegeben. Hätte sich der Offizier aus dem genannten Beispiel einige Meter nach rechts oder links bewegt, ginge die ganze Arbeit wieder von vorn los. Wäre es dann endlich gelungen, das schwere Geschützrohr in den Auflagern zu positionieren, müsste man es zum Schuss noch in Balance halten. Da keine weitere Sicherung erkennbar ist, dürfte sich das Rohr durch den Rückstoß mit ziemlicher Wucht unkontrolliert in Richtung Schütze bewegt haben, während sich die Kugel auf den Weg zum Gegner machte. Wenn dabei jemand getroffen worden wäre, dürfte das Zufall gewesen sein, während mit Sicherheit nach dem Schuss Schütze und Rohr im Schlamm, neben einem schief stehenden "Torausheber" liegen würden.
Nun wurden ein unwahrscheinlicher und ein unmöglicher Bestimmungszweck des "Toraushebers" beschrieben. Wozu er tatsächlich diente, muss vorerst offen bleiben. Er muss den Gesekern nach der Belagerung immerhin als so bemerkenswert aufgefallen sein, dass sie beschlossen, ihn aufzubewahren. Nachfragen bei namhaften militärhistorischen Instituten und Museen haben bisher keinen Hinweis erbracht. Ob er Bestandteil eines kranähnlichen Hebewerkzeugs gewesen sein könnte, mit dem Christians Truppen im nassen April 1622 versuchten, ihre schweren Geschütze aus dem Schlamm zu manövrieren? Vielleicht findet sich irgendwann ein Beleg, wozu der "Torausheber" zu gebrauchen war - außer Spekulationen anzuheizen!
Suche
Kategorien
Datum
Aktuelles
Info: Das Archiv enthält Pressemitteilungen, die älter als 12 Monate sind. Alle jüngeren Pressemeldungen sind hier zu finden.